Mémoire des Vins Suisses
Manchmal muss man rückwärts lesen, um zu verstehen. Denn ohne Vorher gibt es kein Nachher, ohne Vergangenheit keine Zukunft, ohne Erfahrung keine Qualität. Das gilt ganz besonders für das Handwerk der Winzer. Und diese haben jedes Jahr nur eine Chance. Zudem werden Schweizer Weine sehr jung verkauft und getrunken. Kaum jemand kenn deren Reifepotenzial. Auch Weinkritiker verkosten Batterien eingepackter Flaschen, kommentieren die nummerierten Muster mit mehr oder weniger standardisierten Begriffen und verteilen Zensuren mit Noten. Diese Art Annäherung ist systembedingt unpräzis, keinesfalls so, wie die meist als Schlusspunkt gesetzte Benotung zu vermitteln scheint.

Was ist faul an der Sache? Erstens: Die Weine werden meist im Moment ihres Markteintritts verkostet, jung, unfertig, in der so genannten Primärphase des Weins, wenn die Frucht dominiert und – bei Rotwein – die Tannine noch nicht zur Reife gefunden haben. Nicht jedes Gewächs ist jedoch darauf angelegt, sich genau zu diesem Zeitpunkt von seiner besten Seite zu zeigen.
Zweitens: In Grossverkostungen, wie sie meist aus Ressourcegründen durchgeführt werden, setzen sich oft die lautesten, muskulösesten Gewächse durch. Ohne «Doping» geht auch bei Weinwettkämpfen nichts mehr. Die Produzenten kennen die Konzentrations- und Extraktionsmöglichkeiten im Keller und viele haben keine Skrupel, sich ihrer zu bedienen. Sie hoffen, damit ihren Produkten bei den Degustatoren, deren sensorische Wahrnehmungsfähigkeit im Verlauf einer Verkostung nachlässt, die nötige Geltung zu verschaffen. Die Folge: ein standardisierendes Wettrüsten, das zunehmend Unterschiede und Eigenständigkeiten verwischt.
Und drittens: Weinkritiker stellen Vermutungen an, die sie nur selten überprüfen. So wird getesteten Weinen oft ein Alterungs- oder Reifungspotential zugesprochen. Ob und wie sich das einlöst, erfahren wir aber nie. Denn die Medien berichten vorab über das Neue, das jetzt gerade gekauft werden kann.
 Seit 1999 sammelt die Fachjournalistengruppe mit Susanne Scholl, Andreas Keller, Martin Kilchmann und Stefan Keller ausgesuchte Schweizer Weine.
Seit 1999 sammelt die Fachjournalistengruppe mit Susanne Scholl, Andreas Keller, Martin Kilchmann und Stefan Keller ausgesuchte Schweizer Weine.
Ursprünglich ging es ihnen darum, gesuchte Schweizer Weine sicherzustellen. Dann kam die Idee auf, die Entwicklung der Weine über Jahre hinweg zu verfolgen. Damit betrat das Mémoire des Vins Suisses völliges Neuland in der Schweiz.
Jahr für Jahr verfolgen sie deren Entwicklung und können immer mehr unterschiedlich gereifte Jahrgänge vergleichen. Daraus ergibt sich allmählich ein sehr komplexes Bild jedes Weins. Irgendwann sollen verlässliche Aussagen über dessen künftige Entwicklung gemacht werden können. Denn das Heute ist das Gestern von morgen.
Der tiefere Sinn der Mémoire des Vins Suisses besteht letztlich darin, das immer noch unterschätzte Potenzial des Schweizer Weins aufzuzeigen. Entsprechend gross ist das Interesse der Schweizer Weinszene. Im Herbst 2004 erhielten die vier Journalisten anlässlich der Verleihung des ersten Grand Prix du Vin Suisse in Bern für ihre Arbeit den Prix Vinnovation.
Das private Projekt vereint Winzer und Weine aus allen sechs Weinbaugebieten der Schweiz.
Amitié, patrie, promotion
«Freundschaft, Vaterland, Verkaufsförderung: So formulierte eines unserer Mitglieder aus Genf die wichtigsten Ziele von Mémoire des Vins Suisses», sagt Andreas Keller, Gründungsmitglied des Mémoire des Vins Suisses, und erklärt: «Hinter den von uns eingelagerten Weinen stehen Menschen aus allen Teilen unseres Landes, die im wörtlichen und übertragenen Sinn ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Unterschiede hat sich unter den Mémoire-Winzern eine echte Freundschaft entwickelt, die unserer Vereingung den nötigen inneren Rückhalt verleiht. Als praktisch einzige gesamtschweizerische Organisation, die Produzenten aus allen sechs Weinbaugebieten vereint, wagt sie sich darum auch an Aufgaben, an denen die offizielle Weinbranche unseres Landes aufgrund ihrer kantonalen und regionalen Partikularinteressen zu scheitern droht. Ein starker Auftritt der Weinschweiz im In- und Ausland ist für uns sozusagen vaterländische Pflicht, auch wenn wir dafür keinerlei Bundesgelder kassieren. Dass daraus letztlich auch eine wirksame Verkaufsförderung für jeden einzelnen Betrieb resultiert, ist eine logische Folge: Wenn es allen gut geht, geht es auch dem Einzelnen gut.»
Zurück
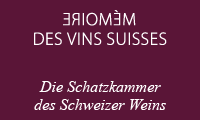
Mémoire des Vins Suisses
Konkordiastrasse 12
8032 Zürich
Tel.: 044 389 60 40
Fax: 044 389 60 46
info@mdvs.ch
www.mdvs.ch



